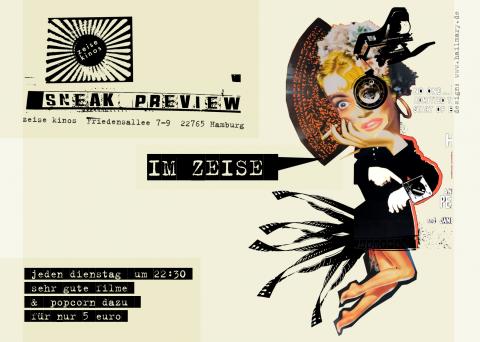"Ostpreußen - Entschwundene Welt" beginnt mit dem dramatischen Untergang der Region im Jahr 1944, bevor er eine Chronologie der Jahre eines in die Geschichte entschwundenen Landes nachzeichnet. Die Zuschauer reisen in den historischen Aufnahmen in die Provinzhauptstadt Königsberg, nach Insterburg, Tilsit, Allenstein, aber in Provinzstädtchen wie Johannisburg, Gerdauen und Heiligenbeil. Motive der Filmemacherinnen und -macher aus mehr als drei Jahrzehnten sind die Frische und die Kurische Nehrung, das Samland, Masuren und das Oberland. Gezeigt werden der Alltag im bedeutenden Agrarland, Sommerfreuden und Winterbeschwernisse, aber auch die Verfolgungen, die die Nationalsozialisten im benachbarten polnischen Masowien, von ihnen jetzt Neuostpreußen genannt, sofort beginnen. Selbst Amateuraufnahmen zeigen den Beginn einer Flucht ohne Wiederkehr (Quelle: bremerfilmkunsttheater.de)
Wilfried Hippen meint in seiner umfangreichen Besprechung in der TAZ vom 15. Mai 2025, die Dokumentation Ostpreussen – Entschwundene Welt biete kein Futter für Revanchisten. „Und ihr Urheber ist ideologisch unverdächtig. Der Bremer Historiker Hermann Pölking nennt sich selbst einen ‚linken Sozialdemokraten‘. Sein Film hat nichts romantisch Verklärendes an sich.“ Pölking, so Hippen, habe den Film zudem sehr geschickt strukturiert und geschnitten. „Bei einem Kompilationsfilm wie diesem besteht die kreative Arbeit des Filmteams vor allem in der Montage.“ Der Filme habe den ansonsten chronologisch erzählten Film mit dem Jahr 1944, dem Beginn der Flucht vor der anrückenden Roten Armee, beginnen lassen. „Pölking hat sich nach anderen Schnittversionen für diese Lösung entschieden, damit die Zerstörung durch sowjetische Soldaten nicht als Zielpunkt der Dramaturgie wirkt.“